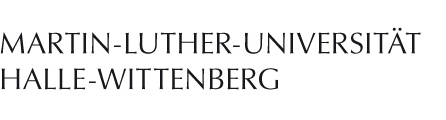Stellungname bzgl. § 219a StGB
Dezember 2017
Der Kriminalpolitische Kreis ist ein Zusammenschluss deutscher Strafrechtsprofessorinnen und -professoren, die sich mit Fragen der Strafrechtspolitik befassen. Nach eingehender Diskussion nehmen wir, die unten gezeichneten Mitglieder dieses Kreises, zur Frage der möglichen Reform oder Streichung von § 219a StGB wie folgt Stellung:
1. Durchdachte Neuregelung statt überhasteter Streichung
Aktuelle Einzelfälle sind für sich allein kein hinreichender Grund für überstürzte Änderungen des Strafrechts, insbesondere wenn einzelne Vorschriften – wie § 219a StGB – Teil eines kompromisshaften, aber in sich abgestimmten Gesamtkonzepts für ein bestimmtes Sachproblem sind. Wenn jedoch eine inhaltlich zweifelhafte Vorschrift auch durch restriktive Interpretation nicht auf einen akzeptablen Kern zurückgeführt werden kann, muss nötigenfalls der Gesetzgeber tätig werden. Dabei sollten jedoch auch die langfristigen Folgen einer Entkriminalisierung – ebenso wie einer Pönalisierung – genau überlegt werden.
2. Keine Strafbarkeit sachlicher Information über tatbestandslosen oder rechtmäßigen Schwangerschaftsabbruch („Anbieten“, „Ankündigen“)
§ 219a StGB verbietet u.a. das Anbieten und Ankündigen von Diensten zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs. Die Strafnorm unterscheidet hierbei nicht zwischen der nach § 218 StGB strafbaren Abtreibung, dem durch medizinische oder kriminologische Indikation gerechtfertigten (§ 218a Abs. 2 und 3 StGB) Schwangerschaftsabbruch und dem tatbestandslosen Abbruch nach erfolgter Beratung innerhalb von 12 Wochen nach Empfängnis (§ 218a Abs. 1 StGB).
Zwischen diesen drei Fällen bestehen aber gravierende Unterschiede. In den letzten beiden, von § 218a StGB geregelten Fällen wird der Schwangerschaftsabbruch – mit unterschiedlicher dogmatischer Begründung – nicht bestraft. Daran soll festgehalten werden. Es ist aber widersprüchlich, wenn das Strafrecht den bloßen Hinweis („Anbieten“, „Ankündigen“) auf ein Verhalten inkriminiert, das selbst kein tatbestandliches Unrecht darstellt.
Der Gesetzgeber von 1981 hat mit § 219a StGB allerdings einen weiteren Zweck verfolgt: Es sollte verhindert werden, „dass der Schwangerschaftsabbruch in der Öffentlichkeit als etwas Normales dargestellt und kommerzialisiert wird“ (BT-Drucks. 7/1981, S. 17). Grund für die Beibehaltung des Werbeverbots nach § 219a StGB trotz der Liberalisierung des Rechts des Schwangerschaftsabbruchs war also auch die Sorge um das moralische „Klima“ in der Gesellschaft: Schwangerschaftsabbrüche sollen in der öffentlichen Diskussion nicht als ethisch unbedenkliche und alltägliche medizinische Maßnahmen dargestellt werden.
Bloße neutrale und sachliche Hinweise auf die Möglichkeit, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen, haben diese relativierende Wirkung jedoch nicht. Ein allgemeines Verbot der öffentlichen Diskussion über Schwangerschaftsabbrüche entspräche auch nicht der gegenwärtigen Situation der deutschen Gesellschaft: Zum einen stellen Fragen der Abtreibung
heute kein Tabu mehr dar, und zum anderen ließen sich allgemeine Redeverbote angesichts der nicht steuerbaren Kommunikation in sozialen Netzwerken ohnehin nicht durchsetzen. Nicht zuletzt ließen sich durch eine Streichung des Verbots sachlicher Informationsweitergabe auch mögliche Konflikte mit der EU-rechtlich garantierten Dienstleistungsfreiheit (Art. 56 AEUV) minimieren.
3. Verbot anpreisender Werbung?
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen bleibt als möglicher legitimer Kern von § 219a StGB das Verbot des „Anpreisens“ von Schwangerschaftsabbrüchen. Eine „rühmende Darstellung“ (so das Reichsgericht in RGSt 36, 143 zum Begriff des „Anpreisens“ in § 184 Nr. 3 StGB aF) des Schwangerschaftsabbruchs kann in der Tat dazu führen, dass die mit einem Schwangerschaftsabbruch verbundenen ethischen Konflikte in der öffentlichen Wahrnehmung verschleiert oder verharmlost werden. Durch eine unbeschränkte aggressive Werbung für Schwangerschaftsabbrüche könnte außerdem auch heute noch das moralische Empfinden eines beachtlichen Teils der Bevölkerung erheblich beeinträchtigt werden. Dies spricht dagegen, § 219a StGB insgesamt ersatzlos zu streichen.
Nach dem Prinzip, dass das Strafrecht nur zur Ahndung schwerer Rechtsgutsverletzungen oder –gefährdungen eingesetzt werden sollte, erscheint es vorzugswürdig, das „Anpreisen“ von Schwangerschaftsabbruch angesichts des relativ geringen Unrechtsgehalts außerhalb des Strafrechts als bloße Ordnungswidrigkeit zu ahnden. Auch andere Fälle unerlaubter Werbung für an sich erlaubtes Verhalten – etwa für den Genuss von Alkohol und Tabak (s. etwa § 35 Abs. 2 Nr. 9 iVm § 20 TabakerzG) – sind nicht als Straftatbestände, sondern als Ordnungswidrigkeiten ausgestaltet.
4. Vorschläge
Auf der Grundlage dieser Überlegungen schlagen wir die folgenden Änderungen vor:
a) Das Verbot des Anbietens und Ankündigens (einschließlich der Bekanntgabe entsprechender Erklärungen) sollte auf tatbestandsmäßige und rechtswidrige Schwangerschaftsabbrüche beschränkt werden, d.h. auf solche, bei denen mangels Beratung oder wegen Nichteinhaltung der Zwölf-Wochen-Frist der Tatbestand des § 218 StGB verwirklicht wird und kein Rechtfertigungsgrund (insbesondere nach § 218a Abs. 2 oder 3 StGB) eingreift.
b) Ein Verbot des „Anpreisens“ auch von Schwangerschaftsabbrüchen, die nicht tatbestandsmäßig bzw. rechtmäßig sind, mag man beibehalten, wenn man in solcher aggressiver Werbung eine Störung der öffentlichen Ordnung erblickt. Ein solches Verbot sollte jedoch nicht mit Kriminalstrafe, sondern als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld bewehrt sein.
Unterzeichnende
Prof.’in Dr. Susanne Beck, Universität Hannover
Prof. Dr. Martin Böse, Universität Bonn
Prof. Dr. Jörg Eisele, Universität Tübingen
Prof. Dr. Volker Erb, Universität Mainz
Prof. Dr. Bernd Heinrich, Universität Tübingen
Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf, Universität Würzburg
Prof.’in Dr. Elisa Hoven, Universität zu Köln
Prof. Dr. Johannes Kaspar, Universität Augsburg
Prof. Dr. Hans Kudlich, Unversität Erlangen-Nürnberg
Prof. Dr. Marco Mansdörfer, Universität des Saarlandes
Prof. Dr. Reinhard Merkel, Universität Hamburg
Prof. Dr. Wolfgang Mitsch, Universität Potsdam
Prof. Dr. Carsten Momsen, Freie Universität Berlin
Prof. Dr. Cornelius Nestler, Universität zu Köln
Prof. Dr. Cornelius Prittwitz, Universität Frankfurt a.M.
Prof. Dr. Andreas Ransiek, Universität Bielefeld
Prof. Dr. Henning Rosenau, Universität Halle-Wittenberg
Prof. Dr. Helmut Satzger, Universität München
Prof.’in Dr. Anja Schiemann, Deutsche Hochschule der Polizei Münster
Prof. Dr. Christoph Sowada, Universität Greifswald
Prof. Dr. Brian Valerius, Universität Bayreuth
Prof. Dr. Tonio Walter, Universität Regensburg
Prof. Dr. Thomas Weigend, Universität zu Köln